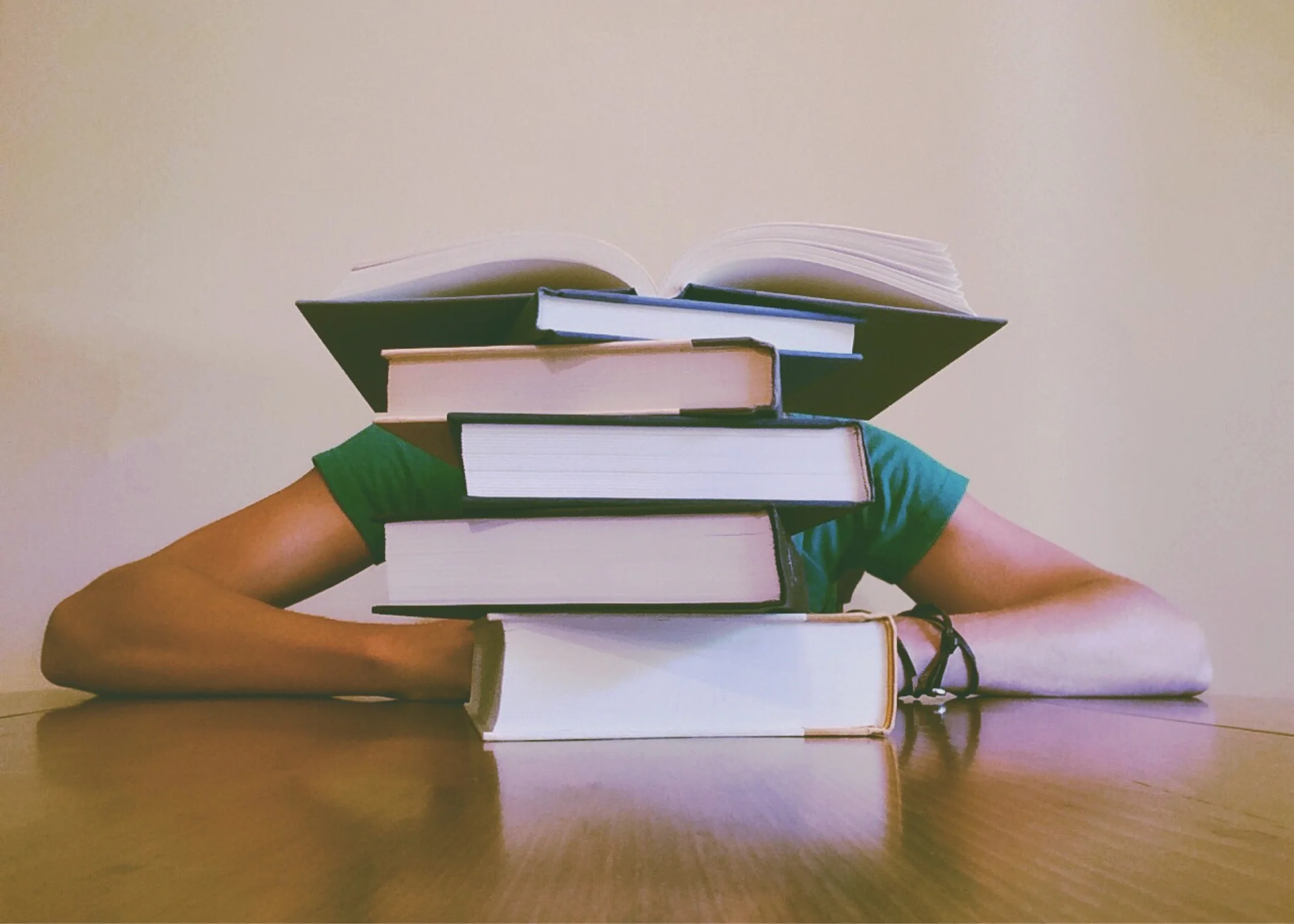
Die Organisation Travail.Suisse Formation will erreichen, dass sich Sehbehinderte vermehrt weiterbilden können. Eine Vertreterin des Bundes erklärt, wieso gerade diese Gruppe profitieren soll.
Travail.Suisse Formation hat sich zum Ziel gesetzt, den Zugang von Weiterbildungen für blinde und sehbehinderte Menschen zu verbessern. Wieso unterstützt das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) dieses Projekt?
Marie-Louise Bartlome (Marie-Louise Bartlome ist beim Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) zuständig für die Leistungsvereinbarungen mit den Organisationen der Weiterbildung im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes.): Lebenslanges Lernen ist sowohl für die persönliche Entwicklung wichtig, als auch für die Gesellschaft und die Arbeitswelt. Wissen und Qualifikationen müssen sich stetig dem gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wandel anpassen. Sehbehinderte Menschen stossen aber häufig auf Hindernisse, wenn sie sich für eine Weiterbildung interessieren.
Dasselbe gilt doch für Menschen mit anderen Beeinträchtigungen, etwa im auditiven, mobilen und kognitiven Bereich. Wieso engagiert man sich nun ausgerechnet im visuellen Bereich?
Bund und Kantone sind bestrebt, die Chancengleichheit für alle Menschen mit Beeinträchtigungen zu verbessern. In der Vergangenheit lag der Fokus wohl etwas stärker auf den Mobilitätsbehinderungen. Beim Stichwort Behinderung denken eben viele zuerst an einen Rollstuhlfahrer. Doch im Bildungsbereich sind Sehbehinderte wohl mindestens so stark gefordert. Denn bei den Bildungsinstitutionen ist das Knowhow, wie man die digitalen Unterrichtsmaterialien für Sehbehinderte zugänglich macht, noch nicht sehr verbreitet. Wenn in der nächsten Periode auch Projekte für andere Beeinträchtigungsformen eingereicht werden, begrüssen wir das natürlich.
Wieso braucht es eigentlich spezielle Massnahmen für den Weiterbildungsbereich? Viele Hochschulen verfügen doch bereits über umfangreiche Leitfäden für Menschen mit Behinderung und setzen vieles schon um.
Hochschulen und Berufsfachschulen werden von den Kantonen und vom Bund subventioniert und haben einen gesetzlichen Auftrag bezüglich Chancengleichheit. Vor allem die grösseren unter ihnen haben diesbezüglich schon viel geleistet. Der Abbau von Hindernissen und die Erfahrungen kommen Behinderten sowohl bei Studiengängen als auch bei universitären Weiterbildungen gleichermassen zugute. Andere Anbieter – vom kleinen Yoga-Studio über die private Informatik-Schule bis zur landesweit tätigen Sprachschule – orientieren sich vor allem an der Nachfrage und der Wirtschaftlichkeit. Sie sind häufig noch wenig sensibilisiert. Am Projekt von Travail.Suisse Formation gefällt uns besonders, dass die gesamte Bevölkerung für die Bedürfnisse von Sehbehinderten sensibilisiert werden soll.
Wieso wurde gerade Travail.Suisse Formation berücksichtigt? Hätte eine Behindertenorganisation nicht mehr spezifisches Knowhow?
Die Anfang 2016 gegründete Organisation Travail.Suisse Formation erfüllt die Voraussetzung, dass sie sich überwiegend mit Weiterbildungsthemen befasst und eine übergeordnete Leistung für das Weiterbildungssystem erbringen kann. So sieht es das Weiterbildungsgesetz vor. Travail.Suisse Formation arbeitet zudem mit Behindertenorganisationen direkt zusammen und profitiert von ihrem Erfahrungsschatz.
Ende November haben Sie am Workshop von Travail.Suisse Formation in Olten teilgenommen, an dem eine Kriterienliste erarbeitet wurde, die eiterbildungsinstitutionen im Umgang mit Sehbehinderten als Leitfaden dienen soll. Was für Eindrücke haben Sie von der Tagung mitgenommen?
Ich fand den Austausch sehr lebendig. Teilnehmer aus allen Landesteilen und Sprachregionen sowie Vertreterinnen und Vertreter von Bildungsanbietern, staatlichen Stellen und Behindertenverbänden diskutierten auf Augenhöhe. Dies ist genau im Sinn der Leistungsvereinbarung. Mindestens so wichtig wie die Überarbeitung des Massnahmenkatalogs war wohl die Begegnung zwischen den verschiedenen Personen. Der inklusive Ansatz ermöglichte es, dass zum Beispiel die Direktorin einer Höheren Fachschule direkt von einer sehbehinderten jungen Frau hörte, welche Hindernisse ihr bei einer Weiterbildung am meisten zu schaffen machen. Auch ich habe vom direkten Kontakt mit Betroffenen profitiert.
In welcher Form?
Ich erhielt die Aufgabe, eine sehbehinderte Studentin, die erst am Mittag zu uns stiess, am Bahnhof abzuholen. Wir benutzten gemeinsam den Bus. Dabei wurde mir bewusst, wie schwierig es ist, sich ohne Augenlicht zu orientieren. Obwohl bereits viele Massnahmen umgesetzt worden sind, gibt es immer noch viele Hindernisse.
Grosse Weiterbildungs-Offensive
Anfang 2017 trat das neue Weiterbildungsgesetz (WeBiG) in Kraft. Damit sollen Transparenz, Qualität und Chancengleichheit bei Weiterbildungen gefördert werden. Handlungsbedarf sieht der Bund vor allem bei den Grundkompetenzen wie Lesen, Schreiben, mündliche Ausdrucksweise, einfache mathematische Kenntnisse und Anwendung von digitalen Technologien. Die Kantone sind angehalten, Strukturen aufzubauen, die insbesondere Menschen aus bildungsfernen Gesellschaftsgruppen zugutekommen und erhalten dafür Geld vom Bund. Parallel dazu stehen Mittel für übergeordnete Leistungen zur Verfügung, welche Organisationen der Weiterbildung erbringen. Diese sollen gesamtschweizerisch tätig, nicht gewinnorientiert sowie nicht auf ein einziges Thema fokussiert sein. Die Organisationen der Weiterbildung konnten Gesuche für Projekte einreichen. Das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) hat mit sieben Partnern Leistungsvereinbarungen abgeschlossen und für die Periode 2017 bis 2020 insgesamt 2,7 Millionen Franken gesprochen. Gut drei Viertel davon gehen an die beiden grossen Player Schweizerischer Verband für Weiterbildungen (SVEB) sowie den Schweizer Dachverband Lesen und Schreiben. Die Arbeitnehmerorganisation Travail.Suisse Formation erhält mit knapp 44’000 Franken zwei Prozent der Gelder. Das Budget ihres Projekts für blinde und sehbehinderte Menschen beträgt 60’000 Franken.